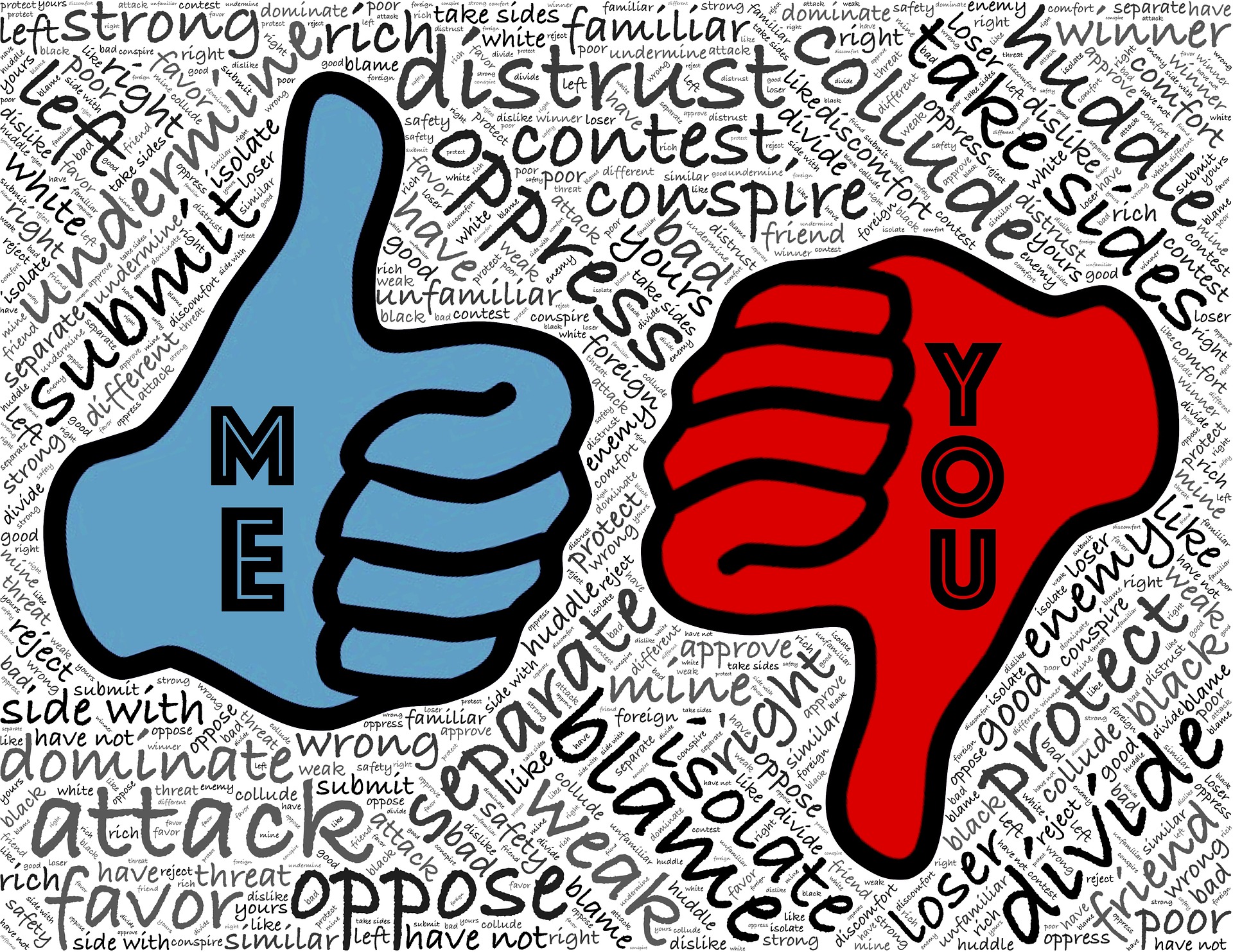Die Piratenpartei und das Konzept einer digitalen Kulturflatrate
Insbesondere die Erfolge der Piratenpartei seit den Berliner Landtagswahlen im Jahr 2011 belebten die politische Landschaft in Deutschland zeitweise massiv. Viele junge Menschen, deren politisches Interesse bis dahin nicht vorhanden war oder verborgen blieb, entschieden sich nun für politische Partizipation. Die dieser Bewegung zugrundeliegenden Ideen richteten sich gegen das gesellschaftliche und politische Establishment, gegen analoge, veraltete und überholte Denkstrukturen. Diese Haltung sowie die plötzlichen Wahlerfolge sicherten den Piraten den Stempel einer Protestwählerpartei. Genährt wurde diese Kritik durch fehlende Konzepte hinter den neuen Ideen, die eine moderne Politik im digitalen Zeitalter versprachen.

Die Piratenpartei ist womöglich das Ergebnis des sich spätestens seit dem Millennium rasant ausbreitenden Internets. Zusammen mit der Verbreitung und zunehmenden Nutzung von Internetanschlüssen entwickelte sich eine große Anzahl sogenannter Tauschbörsen, mit denen es nun möglich war, urheberrechtlich geschützte Werke kostenfrei und unkompliziert zu erhalten und für andere zur Verfügung zu stellen. Dies war die Geburtsstunde der digitalen „Raubkopierer“, eine millionenschwere Gruppe von Menschen, für die das Bewusstsein einer Schädigung anderer durch das eigene Verhalten vor allem aus Sicht von Produzenten kreativer Werke scheinbar noch nicht gewachsen war. Die eigentlich unkorrekte Bezeichnung „Raubkopierer“ kann ein Ausdruck der Diskrepanz zwischen Produzenten und den (unberechtigten) Konsumenten sein: Für die einen ist es ein großes existenzbedrohendes Verbrechen, für die anderen bloß ein simpler Klick in einem einfachen Computerprogramm. Kann ein Verbrechen, das auf solch saubere und einfache Weise geschieht, überhaupt ein Verbrechen sein?
Die Piratenpartei sah die freie Kopierpraxis großer Teile der Netzgemeinschaft als eine implizite demokratische Willensäußerung und wurde diesen Bedürfnissen gerecht, indem sie die Entkriminalisierung der Netzgemeinschaft forderte und Kulturgut zum Gemeingut werden sollte. Viele Kritiker sahen darin die Auflösung des Urheberrechts zugunsten einer Kostenloskultur, welche zwangsläufig zur Verarmung von Künstlern und Kreativschaffenden führen müsse. Dabei handelt es sich hierbei um ein Missverständnis, das nicht zuletzt dem Umstand zuzurechnen ist, dass das Parteiprogramm der Piraten zunächst ein Konglomerat wenig ausgefeilter Ideen ist. Die parteiinternen Diskussionen, die durch den Wunsch nach schlüssigen und sinnvollen Konzepten für die realistische Ausgestaltung der groben Ideen motiviert wurden, gelangten weniger an die Oberfläche. Die Piraten arbeiteten an mehreren Konzepten, die einerseits dem Wunsch nach einer Kostenloskultur gerecht werden und andererseits die Existenzen von Kreativen sichern sollte.
Eines dieser Konzepte ist die Kulturflatrate, welche einen festen monatlichen Betrag kosten und das Kopieren und Nutzen aller Werke legalisieren sollte. Flatrates gehören vor allem durch den Bereich der Telekommunikation und den Rundfunkbeitrag bereits zur Alltagserfahrung eines jeden Bürgers. Eine Kulturflatrate würde jeden Bürger einschließen, sie würde die Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft im sonst eher rohstoffarmen Deutschland unterstützen. Sie würde die Auseinandersetzungen zwischen Universitäten und der Verwertungsgesellschaft Wort auflösen und Studierenden den Zugang zum benötigen Wissen sichern. Auf der anderen Seite kann dieses Konzept nicht erklären, wie die Einnahmen durch die Kulturflatrate gerecht auf die Kreativen verteilt werden sollten; und warum auch die Menschen einen Beitrag leisten sollen, die keinerlei Kulturgut in Anspruch nehmen. Denn schon jetzt wird der Rundfunkbeitrag als Zwangsbeitrag von vielen Menschen abgelehnt.

Derweil gibt es in der Internetgemeinde zwei Tendenzen: Es findet einerseits eine Abkehr von Tauschbörsen und eine Hinwendung zu kostenpflichtigen Diensten wie Netflix (Online-Videothek), Kindle Unlimited (Online-Bücherei) oder Spotify (Musikstreaming-Dienst) statt. Andererseits ist kaum jemand dazu bereit, für die Nutzung von z. B. Online-Tageszeitungen, Apps und sozialen Netzwerken Geld zu bezahlen oder Werbeanzeigen für die indirekte Finanzierung zu konsumieren. Für viele Dienste erscheint der Verkauf von personenbezogenen Daten an Dritte eine gute Lösung zu sein, um den eigenen Finanzierungsbedarf decken und den Wünschen der Konsumenten nach „kostenlosen“ Inhalten gerecht werden zu können. Eine solche Form der „Kostenloskultur“ wäre dabei nicht im Sinne einer sich für Datenschutz einsetzenden Piratenpartei. |von Can Keke